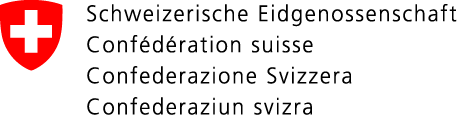Demokratie erfordert Wachsamkeit
Zürich, 04.12.2017 - Rede von Bundesrat Alain Berset anlässlich «The Churchill Europe Symposium 2017» – es gilt das gesprochene Wort.
Churchill ist überall: Auch heute noch. Zum Beispiel im Oval Office, wo der amerikanische Präsident sitzt. Dort stand in der Regierungszeit von George W. Bush eine Churchill-Büste. Sein Nachfolger Barack Obama liess sie entfernen und durch eine Büste von Martin Luther King ersetzen. Ein grosses Politikum! Bedeutete dies das Ende der «special relationship» zwischen den USA und Grossbritannien? Wankte gar die NATO?
Donald Trump – der die transatlantischen Beziehungen kritischer sieht als Obama – liess die Churchill-Büste wieder im Oval Office aufstellen. Aber – und das kommt jetzt vielleicht nicht ganz überraschend – die Büste war ein «fake»! Es war nicht die echte, sondern eine Imitation, wie Historiker bald herausfanden. So erfuhr die Welt, dass es im Weissen Haus zwei Churchill-Büsten gibt.
Und das ist irgendwie typisch, wenn es um Churchill geht. Es gibt zwei Churchill-Büsten im Weissen Haus – und manchmal scheint es fast, als gebe es auch zwei Churchills. So beriefen sich in der Brexit-Debatte sowohl Gegner wie auch Befürworter auf Churchill. Beide Seiten waren sicher, dass der grosse Kriegspremier auf ihrer Seite stünde, wäre er noch am Leben.
Nicht anders verhält es sich auch mit der berühmten Zürcher Rede, derer wir heute gedenken: Churchill wurde und wird von den Freunden der EU als visionärer Europäer gefeiert. Aber gleichzeitig berufen sich die EU-Gegner auf ihn – und auch sie haben gute Argumente.
Seit dem Brexit könnten natürlich Freunde der Dialektik argumentieren, Churchill habe sowohl die heutige EU beschworen – als auch das Abseitsstehen Grossbritanniens vorhergesagt.
Churchill wird von allen Seiten vereinnahmt – ausser, er äusserte sich so kryptisch, dass seine Interpreten verzweifeln: In der Zürcher Rede sprach er nämlich auch davon, Grossbritannien, die USA oder auch die Sowjetunion könnten die Rolle als «Förderer» eines vereinigten Europa übernehmen. Was das bedeuten sollte – darüber streiten sich die Historiker bis heute. Churchill muss für alles herhalten – und auch für dessen Gegenteil.
Das ist auch ein ironisches Echo von Churchills Leben. Er wechselte bekanntlich zweimal die Partei. Er, die personifizierte Unbeirrbarkeit, war in gewissen Phasen seines politischen Lebens auch ein wendiger Taktiker – hart an der Grenze zum Opportunismus. «Wer sich verbessern will, muss sich verändern», antwortete er einem Kritiker, «um also perfekt zu sein, muss man sich oft verändert haben».
Churchills Antwort zeugt von jener selbstironischen Arroganz, die wohl nur ein englischer Aristokrat zustande bringt. Ein Teil seiner Widersprüchlichkeit lag in eben diesem Habitus. Er, der Verteidiger der Demokratie im 20. Jahrhundert, war eigentlich ein Mann des 19. Jahrhunderts. Einerseits ein vom Volk geliebter Staatsmann im Zweiten Weltkrieg, liebevoll «Winnie» genannt. Andererseits ein abgehobener Aristokrat, der von der Realität der Leute kaum etwas wusste.
Der englische Historiker David Cannadine schreibt: «Nie betrat Churchill ein Geschäft, nie fuhr er in einem Bus, und das einzige Mal, dass er die Londoner U-Bahn benutzte, geriet er auf die Circle Line und fuhr hilflos eine Runde nach der anderen, bis ihn nach mehreren Stunden ein Freund von dieser Tortur erlöste.»
Trotz aller Widersprüchlichkeit: Eines ist unbestreitbar und unbestritten. Winston Churchill spielte eine entscheidende Rolle, als es darum ging, die Demokratie zu retten. Und das macht ihn wohl zum grössten europäischen Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Oder in seinem eigenen Duktus gesagt: Winston Churchill war der schlechteste europäische Staatsmann des 20. Jahrhunderts – mit Ausnahme aller andern.
Das Original-Zitat über die Demokratie als die am wenigsten schlechte Staatsform ist ja vor allem berühmt wegen seiner Ironie. Aber es steckt – wie so oft bei Churchills scheinbar lässig hingeworfenen Bemerkungen – mehr dahinter. Nämlich ein Bewusstsein dafür, dass die Demokratie nicht perfekt ist. Dass sie stets gefährdet ist – von innen und von aussen.
Die – bei allem aristokratischen Habitus – tief demokratische Gesinnung äussert sich bei Churchill längst nicht nur in den grossen Reden. Sondern auch im Alltag als Premierminister, auch und gerade während des Krieges: Das Parlament trat auch in den Kriegsjahren wie gewohnt zusammen. Über den Krieg wurde öffentlich debattiert, wobei Churchill die volle Verantwortung übernahm für den Kriegsverlauf. Und das verlangte durchaus Grösse, denn dieser mutete in den Jahren 1941 und 1942 oft desaströs an.
Unbestritten ist auch Churchills Hartnäckigkeit: Er verkörpert bis heute den Kampf – den bedingungslosen Kampf – gegen den Totalitarismus. Er war unbeirrbar der Ansicht, Hitler sei eine tödliche Gefahr für die Zivilisation. Den britischen Premierminister Neville Chamberlain verglich er mit einem Krokodil-Fütterer: „Ein Appeaser ist jemand, der ein Krokodil füttert in der Hoffnung, dieses werde ihn als letzten essen.“
Für diese sture Hellsichtigkeit zahlte Churchill in den dreissiger Jahren einen hohen Preis. Churchills Sensorium für die Gefahren – die existentiellen Gefahren – inspiriert bis heute. Aber Churchill steht auch symbolisch für Umsicht, Souveränität und Gelassenheit. Er war unaufgeregt – Stichwort „stiff upper lip“ – ausser, die Aufregung war wirklich nötig. Er war kein Alarmist – aber als es darauf ankam, schlug er Alarm.
Er wusste: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte lassen sich nur erhalten, wenn sie notfalls militant verteidigt werden. Ängstliche Besitzstandwahrung, wortreiche Beschwichtigung: Das war nicht seine Haltung. Er wusste: Man darf sich nicht einlullen lassen. Man muss wachsam bleiben.
Churchill wusste dank seinem ausgeprägten Geschichtsbewusstsein, dass politische Entwicklungen nicht immer einfach linear verlaufen. Dass Störungen des Gleichgewichts sich nicht von selber wieder ausbalancieren. Dass der gewohnte Trott manchmal auch in den Abgrund führt.
Dieser Churchill’sche mindset ist auch heute wieder nötig. Gewiss: wer die momentane Situation mit den dreissiger Jahren vergleicht, muss sich den Vorwurf der Ahnungslosigkeit gefallen lassen. Jeder direkte Vergleich mit den extremen politischen und gesellschaftlichen Spannungen dieser Zeit verbietet sich.
Gewisse Parallelen sind aber trotzdem erkennbar – und müssten reichen, um ernsthaft über Gefahren zu diskutieren. Die Demokratie ist heute herausgefordert. Der Autoritarismus erlebt weltweit einen Aufschwung. Und in vielen westlichen Staaten bestimmen Rechtspopulisten zunehmend die Agenda – oder sie sitzen bereits mit an der Macht. Diese Gemengelage ist hinreichend beunruhigend, damit auch besonnene Beobachter unruhig werden.
Edward Luce, Kolumnist der Financial Times, schreibt in seinem Buch “Retreat of Western Liberalism”: “Das Scheitern von zwei Dutzend Demokratien seit der Jahrtausendwende und der Abstiegsdruck auf der Mittelschicht des Westens – verursacht durch Globalisierung und Automatisierung – nähren Nationalismus und populistische Revolten. Diese Entwicklungen machen klar, wie naiv die Hoffnungen nach dem Fall der Berliner Mauer waren, dass die liberale Demokratie sich auf einem unaufhaltsamen Marsch durch die Welt befand. Und sie stellen auch den westlichen Glauben an Aufklärung und Fortschritt infrage.»
Von Churchill lernen heisst vor allem: Wenn wir unsere gut funktionierenden Demokratien erhalten wollen, brauchen wir ein scharfes Sensorium für das, was sie gefährdet. Es ist eine Kernaufgabe unserer Zeit, jenes Unbehagen zu entziffern und zu bekämpfen, das den Rechtspopulismus nährt. Wir haben es mit einer Manifestation des Unbehagens, des Protests, der Verunsicherung und der Wut zu tun – aber gleichzeitig entdecken wir in dieser Mischung eben auch genuin demokratiefeindliche und rassistische Überzeugungen.
Diese beiden Aspekte gilt es scharf zu trennen. Wir müssen unterscheiden zwischen legitimen politischen Anliegen und einem Angriff auf demokratische Institutionen.
Wichtig ist, dass wir die Sorgen ernst nehmen – und nicht einfach beiseite wischen.
- Die Ungleichheit nimmt tatsächlich in vielen Ländern zu.
- Immer häufiger reicht eine Arbeitsstelle nicht mehr, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, geschweige denn eine Familie zu ernähren.
- Durch die Finanzkrise hat die Glaubwürdigkeit von Wirtschaft und Politik tatsächlich gelitten.
- Die EU wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als Globalisierungs-Agentur wahrgenommen – und nicht als Projekt der Sicherheit.
- Die Länder an der Peripherie haben immer noch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit.
Und es gibt tatsächlich Migrationsbewegungen, die die europäischen Gesellschaften verändern. Zu deren problematischen Aspekten gehören Wertekonflikte zwischen einer politisierten Form des Islam und den Menschen- und Frauenrechten.
Heimat ist weder links noch rechts: Dieser Begriff steht für gegenseitiges Vertrauen, für Sicherheit, für Zusammenhalt, für geteilte Werte. Das muss man verstehen und ernst nehmen – und nicht als Phantomschmerz beiseite wischen.
Wer Angst hat um seine Heimat, muss dies in einer Demokratie frei äussern können – auch wenn man die Befürchtungen nicht teilt. Auch wenn man die politischen Forderungen bekämpft, die aus ihnen abgeleitet werden. Man muss den politischen Populismus als Frühwarnsystem begreifen.
Populismus wird dann gefährlich, wenn die herrschende Politik und die Wirtschaft die Kritik an Missständen als reine „Bewirtschaftung von Problemen“ und als „diffuses Unbehagen“ abtut. Oder wenn man bei politischen Entscheiden von „Alternativlosigkeit“ spricht. Es gibt in der Demokratie immer Alternativen, solange sie nicht den demokratischen Grundwerten zuwiderlaufen. Es gibt immer mehrere mögliche Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit. Die Demokratie ist ein nationales Selbstgespräch, das nie abbricht. Sie kann nicht auf Autopilot geschaltet werden.
Das Gefährliche am Populismus ist, dass er die Institutionen angreift. Dass er die Tendenz hat, die Volkssouveränität als absolut zu setzen – und den Rechtsstaat als Eliten-Vehikel zu sehen und zu schwächen.
Daher muss man vehement darauf beharren, dass unsere Demokratien auf drei Säulen ruhen: Auf der Volkssouveränität, auf dem Rechtsstaat und auf den demokratischen Institutionen.
Die verantwortungsbereiten und verantwortungsfähigen politischen Kräfte sind verpflichtet, den Rechtspopulisten mit Argumenten und mit politischen Taten entgegenzutreten. Unser Ziel ist klar: Die Bürgerinnen und Bürger müssen wieder davon überzeugt sein, dass sie ihre Lebensumstände mitbestimmen können – und nicht einfach hilflos ausgeliefert sind, sei es der Globalisierung, der Europäisierung, der Finanzwirtschaft, den Migrationsströmen oder der Prekarisierung.
Wenn wir das grassierende Gefühl des Ausgeliefertseins nicht ernst nehmen, dann werden die Lösungsvorschläge immer extremer.
Andererseits gilt es aber auch, alles zu tun, um diese fundamentalen Kritiker zu überzeugen – manchmal auch, indem man offen sagt, dass sich nicht alle Probleme einfach so lösen lassen. Der wirtschaftliche Strukturwandel führt zu gesellschaftlichen Verwerfungen, die Digitalisierung zwingt zu ständiger Weiterbildung, der demographische Wandel macht Reformen des Rentensystems und des Gesundheitswesens unverzichtbar.
Das deutlich auszusprechen braucht einen gewissen Mut – Applaus jedenfalls darf man nicht erwarten. Aber das gehört zur Verantwortung aller Akteure in unserer Demokratie. Denn wer leere Versprechungen macht, wer Probleme kleinredet, der vergrössert sie. Auch in diesem Punkt darf man sich durchaus etwas an Winston Churchill orientieren.
Zu Churchill fällt einem spontan ein Attribut ein: überlebensgross. Das Lebenswerk, die Schaffenskraft und die schiere Länge seines politischen Lebens sind beeindruckend – und sprengen heutige Massstäbe – vielleicht auch heutige Massstäbe an ideologische Kontinuität und Kohärenz, was im Zeitalter der Polarisierung einerseits irritiert – andererseits auch durchaus erfrischt.
1898 nahm er teil am letzten Kavallerieangriff des Empire – und er begriff die strategischen Herausforderungen des nuklearen Zeitalters. Er schrieb 1931 einen populärwissenschaftlichen Essay über ein breites Spektrum von zukunftsträchtigen Themen – von drahtlosen Telefonen bis Roboter, von Tieren, die im Labor geschaffen werden würden bis zur Frage, wie die Nuklear-Energie zivil und militärisch eingesetzt werden könnte.
Als Churchill Finanzminister war – ja, das war er auch noch – unterbrach er an einem Sonntag im April 1926 seine Arbeiten am Budget und diktierte einen Essay über Quanten-Theorie! So etwas ist heute unvorstellbar – nicht einmal im Land der Schuldenbremse.
Larger than life – aber Winston Churchill war doch auch ein Mensch. Auf dem Höhepunkt seines internationalen Ruhms – 1945 – wurde er als Premierminister abgewählt. „Vielleicht“, meinte seine Frau Clementine, „ist das ein getarntes Glück“. „Im Moment“, erwiderte Churchill, „ist es allerdings ein sehr gut getarntes Glück.“ Der Jahrhundert-Held übernahm – trotzig, aber auch demütig – die undankbare Rolle des Oppositionsführers.
George Orwell sagte einst über Churchill: «Er war mehr Mensch als Staatsmann». Sicher, Orwell sprach vom Literaten Churchill, aber der ist vom Politiker ja nicht wirklich zu trennen. Europas grösster Politiker war «mehr Mensch als Staatsmann». Vielleicht ist das das grösste Kompliment an den Mann, der die Demokratie – die Staatsform des Menschlichen – gerettet hat.
Adresse für Rückfragen
Peter Lauener, Mediensprecher des EDI, Tel. +41 79 650 12 34
Herausgeber
Generalsekretariat EDI
http://www.edi.admin.ch